Von Prof. DDr. Johannes Huber
Einige Aspekte der Genderbewegung führen uns gerade zurück ins Mittelalter, also in die Zeit vor der Aufklärung, die Vernunft und Wissenschaft erstmals über Religion und Dogmatik stellte. Das zeigt eine aktuelle wissenschaftliche Diskussion. Es geht darum, dass sich Krankheitsarten, Krankheitsanfälligkeiten und Krankheitsverläufe bei Männern und Frauen unterscheiden.
So etwa hat COVID-19 gezeigt, dass das männliche Immunsystem ein anderes als das weibliche ist. Männer erkranken viel eher und tendenziell schwerer als Frauen. Insgesamt sterben Frauen seltener an Infektionen. Außerdem bekommen sie Herzinfarkte im Schnitt acht Jahre später als Männer und leben überhaupt länger. Dafür leiden sie häufiger an Autoimmunkrankheiten. All dies ist nicht durch unterschiedliche Verhaltensweisen erklärbar, sondern nur durch eine unterschiedliche Biologie.
So weit ist das wenig überraschend. Auch medizinische Laien nehmen diese Unterschiede wahr. Allerdings birgt es eine Ungerechtigkeit. Die Pharmaindustrie setzt bei ihren Zulassungsstudien für neue Medikamente zum überwiegenden Teil Männer als Probanden ein, und selbst bei den vorausgehenden Versuchen an Tieren kommen hauptsächlich männliche zum Einsatz. Männliche Ratten, Affen oder Katzen zum Beispiel.
Was logischerweise dazu führt, dass die Wirkungen, die Medikamente erzielen, auf Männer zugeschnitten sind, während Frauen andere Medikamente oder andere Zusammensetzungen der gleichen Medikamente benötigen könnten. Frauen leiden so auch häufiger und stärker an Nebenwirkungen. Das führt zu einer Ungerechtigkeit, der die Wissenschaft den Namen Gender Health Gap gegeben hat, wie auch in meinem neuen Buch Die Kunst des richtigen Maßes – Wie wir werden, was wir sein können nachzulesen ist.
Medizin und Biologie wollen diese Ungerechtigkeit durch geschlechterspezifischere Forschung beseitigen, doch da kommen ihnen Proponenten der Gender-Bewegung in die Quere. Obwohl die genannten Unterschiede empirisch und statistisch belegt sind, wollen sie davon nichts wissen. Für sie ist das Geschlecht keine Frage der Biologie, sondern gleichsam eine der Lebenseinstellung. Wir sollen uns so zwischen männlich, weiblich und diversen anderen Optionen entscheiden, wie wir uns einst beim Eintritt in die Oberstufe des Gymnasiums zwischen Latein, Französisch und Russisch entschieden haben.
Anders ausgedrückt: Diese Proponenten der Genderbewegung stellen ihre neue Geschlechterreligion über die Wissenschaft und ihre Dogmatik über die Vernunft. Dazu stehen sie auch. In ihrer Vision für die biologische und medizinische Forschung erklären sie, dass es einer „sorgfältigen Revision des bisherigen Forschungsstandes“ bedürfe. Zudem sollen die „Ideologie des Szientismus“ und die „naive Wissenschaftsgläubigkeit“ abgeschafft werden. Absurd, dass ausgerechnet die Genderbewegung damit den Frauen die Gleichbehandlung in der medizinischen Forschung verwehrt.
Besonders der sogenannte Queer-Feminismus, ein Segment innerhalb der Gender Studies, argumentiert anti-biologisch. Besonders er will die Welt vom „Diktat der Geschlechtszugehörigkeit“, wie es in einschlägigen Schriften heißt, befreien.
Dabei sind die Unterschiede empirisch und statistisch dermaßen eindeutig belegt wie der Unterschied in der Fortbewegung zwischen Vögeln und Raupen, der Unterschied im Kommunikationsverhalten zwischen Pavianen und Walen oder der Unterschied in der Körperbehaarung zwischen Nacktschnecken und Koala-Bären. So etwa ist die Immunantwort weiblicher Entzündungszellen selbst in der Petrischale deutlich unterscheidbar von jener männlicher Entzündungszellen, wie die Wissenschaftsjournalistin Judith Blage in einem in der FAZ erschienenen Artikel mit dem Titel Das Geschlecht in der Praxis schrieb.
Dennoch werfen die Gender- und Queerfeministen den Forschern, die diese Ungerechtigkeit beseitigen wollen, jetzt Ewiggestrigkeit vor. Der überregionalen französischen Tageszeitung Le Monde war die Diskussion darüber schon einen Bericht wert und in England haben sich Wissenschaftler zu einer Gegenoffensive zusammengetan. Konkret hat die britische Entwicklungsbiologin Emma Hilton gemeinsam mit der neuseeländischen Feministin Jenny Whyte das Project Nettie ins Leben gerufen. In dessen Rahmen führen sie eine internationale Liste von bereits mehr als hundert renommierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die weiterhin die „Realität des biologischen Geschlechts, das unabhängig und außerhalb der menschlichen Gesellschaft existiert“, anerkennen.
Dass wir Mediziner eine solche Diskussion jemals wieder zu führen haben würden, hätten wir noch vor zwanzig Jahren für vollkommen ausgeschlossen gehalten. Und dass die Genderbewegung mit ihren Visionen nicht nur die Biologie, sondern auch alle anderen wissenschaftlichen Disziplinen „neu evaluieren“ und in der Folge umgestalten will, lässt sich nur als gefährliche Drohung verstehen. Wenn Naturgesetze auf einmal wieder politisch verhandelt werden, krallt sich das neue Mittelalter einen heiligen Kral unserer Kultur und zieht auch ihn ins Dunkle. Ich kann als Arzt nur klar, deutlich und laut sagen: Es ist höchste Zeit, dass wir als Mehrheit der Vernunft diesem üblen Treiben Einhalt gebieten.
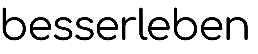









Hinterlasse einen Kommentar